Die Freiheit nehm ich dir
Über Sinn und Unsinn des Strafvollzugs - eine Buchbesprechung
– erschienen in: der lichtblick Heft No.400 –
Die mächtigen Großbuchstaben auf dem Cover des neuen Buchs von Joachim Walter, gerade bei Westend erschienen, lassen die Gewaltförmigkeit des Ortes erahnen, an den uns der Autor mitnimmt. Wir folgen ihm in einige deutsche Gefängnisse, dorthin, wo er als Anstaltsleiter einen Großteil seines Erwerbslebens verbracht hat, und werden im Untertitel bereits darauf vorbereitet, dass im Strafvollzug Sinn und Unsinn gleichermaßen zu haben sind. In 24 Episoden erzählt Joachim Walter von Begebenheiten hinter Gittern und von Männern, deren Schicksale sich dort kreuzen. Er selbst, das wird schnell klar, ist einer von ihnen.
Es werden immer wieder Geschichten publiziert, die in Gefängnissen spielen. Selten aber wird, wie im Fall dieser Neuerscheinung, entlang der professionellen Biografie eines Anstaltsleiter erzählt, wie es auch denen im Vollzug geht, die bleiben müssen, wenn der andere abends nach Hause geht. Die Frage, die der Titel gerade noch wortspielerisch aufgeworfen hat, wer denn eigentlich wem die Freiheit nimmt und nehmen darf (und vor allem auch wie!) beantwortet sich in jeder der Episoden ein bisschen anders. Eine aufklärerische Note bekommt die Geschichtensammlung außerdem dadurch, dass jedem Kapitel auf Anraten des Verlags Informationen und Daten vorangestellt wurden, mit denen der »Situation und Problematik des heutigen Strafvollzugs Rechnung getragen werden soll«. Die Episoden stehen nicht als Prosa für sich, sie stehen im Kontext mit noch immer aktuellen Fragen zur Behandlung von Strafgefangenen. Dies wird besonders dort deutlich, wo Walter über inhaftierte junge Männer im Jugendstrafvollzug schreibt.
Als promovierter Jurist wird Walter natürlich um die Differenz wissen, die dem Wortspiel im Titel seines Buches zugrunde liegt – zwischen der Möglichkeit des Staates, jemandem die Freiheit und damit für eine gewisse Zeit ein Grundrecht zu nehmen, und einer Freiheit, die sich jemand anderen gegenüber herausnimmt, um darauf sein persönliches Handeln (und gegebenenfalls sein Glück) zu gründen. Bezogen auf das Gefängnis als einem Ort, an dem der Staat Menschen unter anderem zum Schutz der Allgemeinheit einsperrt, hat Joachim Walter allerdings nie einen Hehl daraus gemacht, wie wenig er von dieser Art des Strafens hält. Er sei mit den Jahren – im Vorgriff auf eine Art Fazit in seinem Buch sei dies schon hier verraten – immer mehr zum Abolitionisten geworden; zu einem, der «von der vollständigen Abschaffung des Gefängnisses träumt«. Interessierten Gesprächspartner:innen empfahl er allerdings früher schon gern die Lektüre von »Last one over the Wall« von Jerome Miller – die Beschreibung eines außergewöhnlichen Experiments, bei dem in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts im US-Staat Massachusetts Jugendgefängnisse aufgelöst und andere Formen des Umgangs mit den Freigelassenen erprobt wurden. Auch dieser Buchtipp ließ bereits erahnen, dass der Autor Joachim Walter, auf dem roten Störer als ›Gefängnisdirektor‹ angekündigt, tatsächlich nicht zu jenen Verantwortlichen im strafvollzuglichen Betrieb der Bundesrepublik gehörte, die um jeden Preis an der bestehenden Praxis von Strafen durch Freiheitsentzug festhalten woll(t)en.
Walters Gefängniskarriere begann Anfang der 70er Jahre. Er hat die studentischen Schulden noch nicht zurückbezahlt, da bietet man ihm die Stelle des stellvertretenden Chefs der Justizvollzugsanstalt Heilbronn an. Mit dem ihm eigenen trockenen Humor kommentiert er den beruflichen Schnellstart, der selbst ihn, der doch eigentlich als Strafverteidiger der »notorischen Straflust im Justizapparat [hatte] entgegenarbeiten« wollen, überrascht, seiner Frau gegenüber mit den Worten: »Die Zukunft kann kommen, ich geh‘ in den Knast!« Jubel. Das Buch beginnt trotzdem mit der Erwähnung einiger Störungen.
Störung eins: der Lärm. Eindrücklich entwirft Walter das, was im Gefängnis Heilbronn (und nicht nur dort) der akustische Normalzustand war. Ob morgens Abrücken zur Arbeit, mittags Zelleneinschluss zum Essen oder abends Abrücken zum Hofgang, jedes Mal ist das ganze Gefängnis in Bewegung und ein Gemisch aus stampfenden Stiefeln und dem Schlagen schwerer Eisentüren, aus Lautsprecherdurchsagen und dem unentwirrbaren Stimmengewirr hunderter Männer verursacht einen ohrenbetäubenden Lärm. Die typische offen-panoptische Bauweise vervielfacht den Schall. Eigentlich, so erinnert sich Walter an seine ersten Monate als Sous-Chef im Knast, war die Arbeit eine einzige Belastung. Er fängt an, Tagebuch zu schreiben. Das erste und einzige Mal in seinem Leben. Und er fragt sich, was das eigentlich ist, was ihm solche Probleme bereitet. Wirklich der Lärm? Doch der Geruch? Oder ist es die Zusammenarbeit mit den teils ruppigen Vollzugsbeamten? Nein, all das nicht. Was ihn irritiert und mitnimmt, das ist die Tatsache, dass die inhaftierten jungen Männer sind wie er: noch unter dreißig und »in der Blüte ihres Lebens«. Und ein gewichtiger Unterschied fällt ihm auf: Die allermeisten von ihnen hatten, anders als er selbst, »nie die Chance auf eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben«.
Störung zwei: das Ressentiment. Anfang der 70er Jahre gehen Gesellschaft und Belegschaft noch davon aus, dass Straftäter im Gefängnis vor allem büßen sollen, für das, was sie getan haben; es geht um Strafe und Vergeltung, die Idee der Resozialisierung ist noch in weiter Ferne. Walter hingegen versteht nicht, wie ein »weit abgesenkter Lebensstandard« im Gefängnis den Gefangenen helfen soll, bessere Menschen zu werden und nach der Haft ein straftatfreies Leben zu führen. Er hatte als Jurist der Gerechtigkeit dienen wollen, aber doch nicht solcherart »überkommenen Ressentiments«. Mit dieser Haltung macht er sich, wie er feststellen muss, wenig Freunde.
In der Rückschau sorgt diese Haltung – nicht nur in dubio pro reo zu sein – für die notwendige Spannung, wie sie das Buch eines Gefängnisdirektors über (s)ein Gefängnis gut brauchen kann. Da redet bzw. schreibt einer Tacheles. Auch wenn »Die Freiheit nehm‘ ich dir« nicht zum großen Leak taugt (unsinnige Aspekte von Strafvollzug sind ohnehin seit Jahrzehnten in vielen Studien belegt, finden nur nicht entsprechend Gehör bei der Politik), so taugt die Art und Weise, wie hier von einem Insider über den deutschen Strafvollzug geschrieben wird, doch zum Plädoyer für einen anderen Blick: auf gesellschaftliche Missverhältnisse etwa anstatt auf persönliche Schuld; auf einen eklatanten Mangel an Chancengleichheit, der vor allem junge Männer aus prekären Lebensverhältnissen trifft, oder auf die kontraproduktiven Folgen von Disziplinarmaßnahmen, so genannten ›Hausstrafen‹. In ›Die Freiheit nehm‘ ich dir‹ beschreibt Joachim Walter den Gefängnisalltag an den Schnittstellen, an denen Anstaltsleiter und Inhaftierte sich begegnen; zunächst im Männergefängnis Heilbronn, dann im Jugendgefängnis Pforzheim und anschließend im Jugendgefängnis Adelsheim, das er bis zu seiner Pensionierung über 20 Jahre leitete.
Die Episoden weisen Walter als jemanden aus, der sich geschickt zwischen unterschiedlichen Ordnungen und gesetzlichen Vorschriften bewegen kann. Mitunter wagt er ein Tänzchen. Aber nicht alle Episoden lesen sich so leicht wie die Geschichte eines jungen Inhaftierten, der einen Besuchsantrag für seinen Hund stellte. Walter stimmt zu und findet sich selbst an der Leine eines Kampfhundes wieder, den er eigenhändig – versprochen ist versprochen – ins Gefängnis führt und nach einer Stunde Ballspiel zu dritt durch die Schleuse wieder hinaus. Auch die Geschichte der drei Gefangenen, die beim Außeneinsatz auf einer Baustelle außerhalb der Anstalt zufällig in einem alten Schrank einen Revolver finden und den Aufsichtsbeamten aus Spaß mit einer eindeutigen Geste und einem schroffen »Hände hoch!« erschrecken, geht am Ende gut aus. Der Revolver war nicht geladen.
Walter erzählt aber auch von den tragischen Seiten des Strafvollzugs, etwa vom Fall eines Inhaftierten, dem vorgeworfen wurde, mit dem Anstaltsmesser die Gitterstäbe vor seinem Zellenfenster angesägt zu haben. Walter, damals noch ohne Hausstrafbefugnis und daher im Verfahren gegen den Gefangenen ohne Stimme, muss mit ansehen, wie er wegen eines Ausbruchsversuchs vom Anstaltsleiter zu zwei Wochen »geschärftem Arrest« verurteilt wird, eine Disziplinarmaßnahme, die ob ihrer körperlichen und psychischen Folgen mittlerweile verboten ist. Am achten Tag findet Joachim Walter ihn erhängt in der Arrestzelle. Ihm wird schlecht. Er schwankt zwischen Entsetzen, Hilflosigkeit, Selbstverachtung und Wut. Er spürt Gewissensbisse. »Das ist kein Albtraum«, schreibt er in sein Tagebuch. »Das ist brutale Wirklichkeit!« Dass Joachim Walter gleich zu Beginn seiner Karriere als Gefängnisdirektor mit dieser brutalen Wirklichkeit konfrontiert wurde, hat ihn geprägt. Er versuchte im Gefängnis, auch in seiner Funktion als eingesetzter Vertreter des Staates immer auch der Anwalt der Inhaftierten zu sein und widersetzte sich, wo er Anweisungen aus dem Justizministerium für unsinnig hielt. Das traf – wie sich leicht erklären lässt – vor allem auf die Durchsetzung von Disziplinarmaßnahmen zu.
Lesenswert!
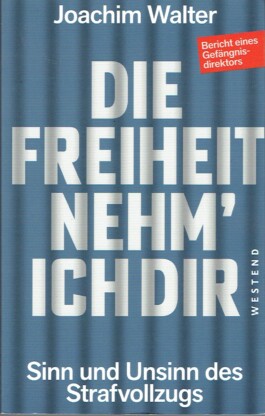
Joachim Walter
Die Freiheit nehm' ich dir
Westend Verlag Neu Isenburg 2025